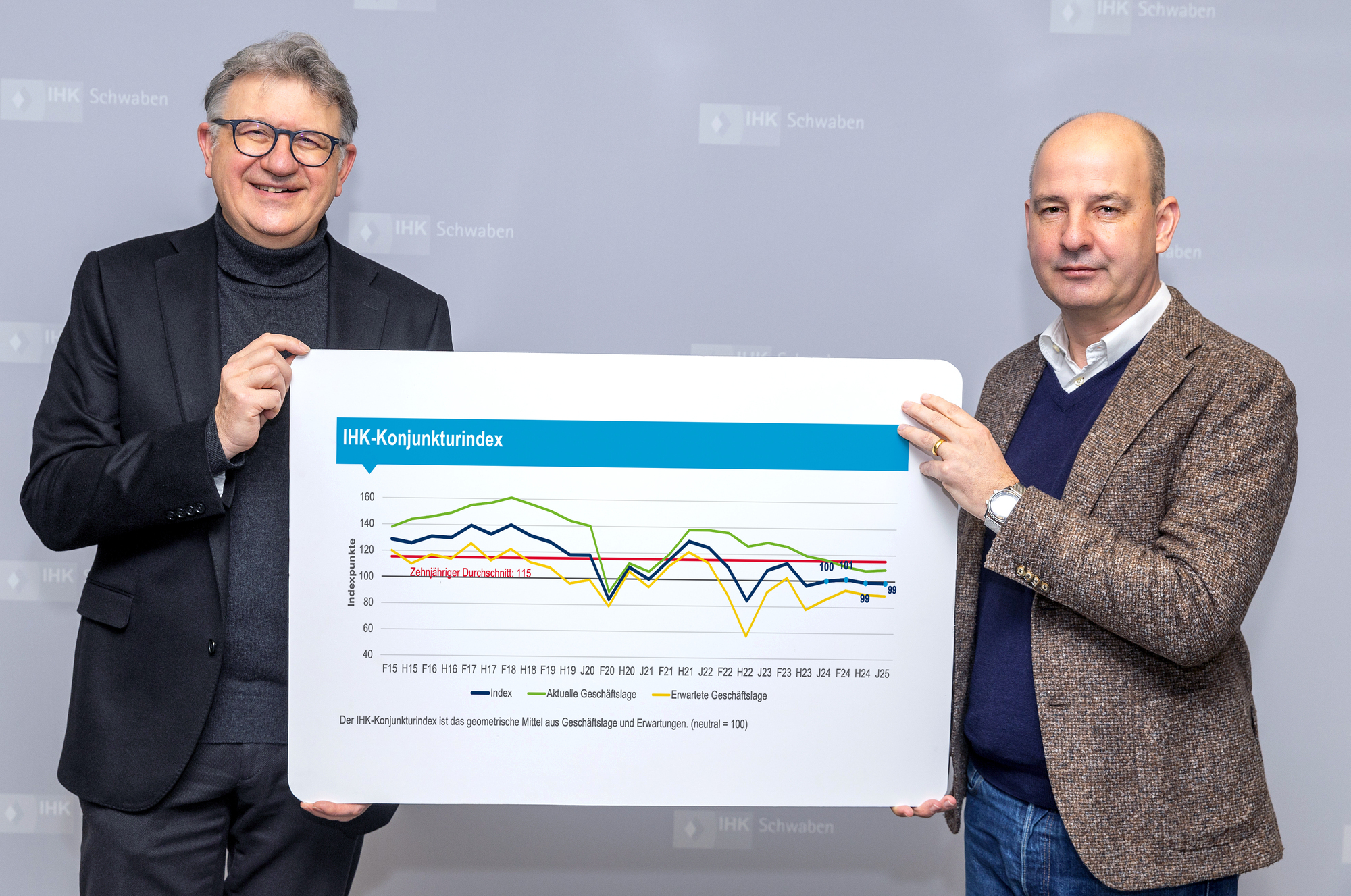Symbolbild. Künstliche Intelligenz und ihre Nutzung sind in aller Munde. Foto: stock.adobe.com / lassedesignen
Seit Sonntag, dem 2. Februar 2025, greift der EU AI Act, ein übergreifendes Regelwerk, das die Nutzung von KI zu regulieren und den Missbrauch zu verhindern versucht. Passend dazu veröffentlichte die IHK Schwaben nun ihren KI-Report 2025. Findet künstliche Intelligenz in Bayerisch-Schwaben Anklang?
Ende jeden Jahres befragt die IHK Schwaben ihre Mitgliedsunternehmen nach ihrem Stand der Digitalisierung. Für den vorliegenden KI-Report wurden 180 Unternehmen der Bereiche Produktion, Handel und Dienstleistung befragt. Dies entspreche einer repräsentativen Stichprobenmenge.
Bereits fortgeschrittener Grad an Digitalisierung vorhanden
Die Digitalisierungsreife der Unternehmen in Bayerisch-Schwaben ist unterschiedlich: Während 19 Prozent sich noch am Anfang befinden und aktuell nur eine Grundausrüstung wie E-Mail- und Office-Programme nutzen, haben 28 Prozent bereits erste Schritte unternommen, um die eigene Digitalisierung voranzutreiben. 41 Prozent hingegen sind fortgeschritten, sprich, diese Unternehmen setzen beispielsweise bei der Buchhaltung oder dem Kundenmanagement auf digitale Lösungen. 10 Prozent der regionalen Unternehmen gelten, aufgrund der Nutzung von Automatisierungen und künstlicher Intelligenz, bereits als hochgradig digitalisiert. Bei den verbleibenden 2 Prozent spielen digitale Technologien in allen Geschäftsbereichen eine entscheidende Rolle, damit sind diese Unternehmen vollständig digitalisiert.
Die Betrachtung der Branchen verdeutlicht ferner, dass Dienstleistung und Handel der Produktion voraus sind, denn in letzterem Sektor ist noch keines der Unternehmen vollständig digitalisiert.
KI als Wettbewerbsvorteil, Herausforderungen bei der Umsetzung
Ob KI für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit eine Rolle spielt, bewerten die Unternehmen differenziert: 50 Prozent schreiben KI hier eine große bis sehr große Bedeutung zu, 24 Prozent glauben, dass die Technologie eine mittlere Rolle spielen wird. 26 Prozent der bayerisch-schwäbischen Unternehmen geben hingegen an, dass künstliche Intelligenz für sie in Zukunft nur eine „eher geringe“ bis „unbedeutende“ Wichtigkeit haben wird.
Ferner verdeutlichen die Umfrageergebnisse branchenübergreifende Unterschiede. Während produzierende Unternehmen KI als sehr relevant erachten (57 Prozent), sind Dienstleistungsunternehmen zurückhaltender, insgesamt 58 Prozent entschieden sich hier für eine „mittlere“ bis „unbedeutende“ Bedeutung.
Die Frage „Welche Hindernisse sehen Sie für die KI-Nutzung?“ ergab darüber hinaus, dass vor allem fehlendes Wissen und unklare rechtliche Rahmenbedingungen es den Unternehmen erschweren, KI bereits aktiv zu nutzen. Auch Datenschutz wird als großer Faktor genannt.
Welche Art der KI wird genutzt?
Von den Befragten, die bereits KI nutzen (57 Prozent), setzen 39 Prozent auf generative KI und 18 Prozent auf andere Systeme. Der Großteil der Unternehmen (71 Prozent) verwendet hierfür kommerzielle Standardsoftware, teilweise intern angepasst (26 Prozent), während 31 Prozent individualisierte Open-Source-Software nutzen. 37 Prozent der IHK-Unternehmen geben hingegen an, eine Software externer Anbieter oder eigens entwickelte Software zu nutzen.
Auch ist erwähnenswert, dass 37 Prozent angaben, dass zukünftig keine Nutzung von KI geplant ist, egal in welcher Form.
Wie die Branchen KI einsetzen
Der KI-Report zeigt weiter, dass künstliche Intelligenz in vielen Unternehmensbereichen eingesetzt wird, die Schwerpunkte jedoch nach Branche variieren. Während die Produktion KI primär im Bereich der Beschaffung nutzt, setzen Dienstleister vermehrt für die Kundeninteraktion auf die Technologie, beispielsweise zur Optimierung der Beratung. Bei Unternehmen der Handelsbranche kommt KI größtenteils bei Marketing und Vertrieb zum Einsatz.
Für Prozesse der Logistik wird KI bisher kaum verwendet.
Unternehmen wünschen sich bessere Rahmenbedingungen und Fördermittel
Digitalisierung ist für die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben weiterhin wichtig. Damit diese allerdings effektiv voranschreitet, fordern die Befragten unterschiedliche Rahmenbedingungen durch die Bundes- beziehungsweise Landesregierung.
Am häufigsten genannt wurden ein einfacher Zugang zu Fördermitteln sowie digitale Verwaltungsprozesse, dicht gefolgt von klaren rechtlichen Rahmenbedingungen und steuerlichen Förderungen für Investitionen in digitale Technologien. Die Förderung von Start-ups und Innovationen an sich sowie eine digitale Infrastruktur innerhalb der Städte spielt für die Unternehmen hingegen eine untergeordnete Rolle.